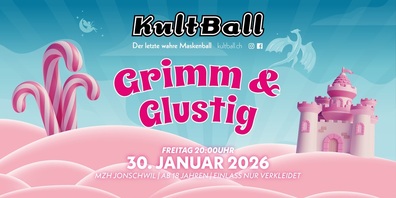Der 3. Sessionstag - 20. September 2023: Zankapfel Verkehr
Der dritte Sessionstag steht ganz im Zeichen von Strassen und Verkehr. Im 7. ÖV-Programm sind in verschiedenen Regionen des Kantons Angebotsverbesserungen von rund 400 Millionen vorgesehen. Deshalb ist das Programm von links bis rechts unbestritten. Grosses Gewicht wird insbesondere auf den Ausbau des Vollknotens St. Gallen gelegt. Beat Tinner hat versichert, dass der Kontakt diesbezüglich über die st. gallischen Bundesparlamentarier bereits hergestellt und das Anliegen der Ostschweiz in Bern angekommen ist. Zudem soll aufgrund der chronischen Verspätung des Euro-Citys München-Zürich eine Entflechtung mit dem Taktfahrplan stattfinden. Unzufriedenheit löst die Tatsache aus, dass der Ausbau der Agglomerationsprogramme verspätet ist und dadurch bereitgestellte Bundesgelder gefährdet sein könnten.
Grosse Diskussionen hat jedoch das 18. Strassenbauprogramm ausgelöst und zu einer Flut von Anträgen geführt. Das Strassenbauprogramm enthält nicht nur den unbestrittenen Unterhalt der bestehenden Strassen, sondern beinhaltet eben auch neue Strassenprojekte wie die Engpassbeseitigung in St. Gallen, welche vom Stadtparlament aus dem Richtplan gestrichen wurde, oder die Autobahnanschlüsse Wil-West und Rorschach, die Netzergänzung Nord in Wil oder den Umfahrungstunnel in Rapperswil-Jona. Exemplarisch erwähnt sei hier die Diskussion über die Engpassbeseitigung in St. Gallen. Die Grünen stellen nicht ganz unberechtigt die Frage, ob es sinnvoll sei, für über eine Milliarde Schweizerfranken einen Zubringer ins Appenzellerland zu bauen, wenn wir den kürzlich fertiggestellten Ruckhaldentunnel für die Bahnstrecke St. Gallen-Appenzell für 40 Millionen Franken gebaut haben. Zudem wird die Verkehrsentlastung von den Gegnern vehement bestritten; sie warnen vor Mehrverkehr, der insbesondere im Zentrum der Stadt St.Gallen zum Verkehrskollaps führe. Die Befürworter argumentieren genau umgekehrt und warnen vor einem Verkehrskollaps, sollte das Projekt Güterbahnhof mit Liebeggtunnel nicht realisiert werden. Sie versprechen sich eine deutliche Verkehrsentlastung für ganze Quartiere. Tatsache bleibt, dass zusätzliche Strassen zusätzlichen Verkehr anziehen und damit die breit abgestützten Verlagerungsziele kaum erreicht werden können. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse bleibt die Engpassbeseitigung im 18. Strassenbauprogramm. So oder so - eine Abstimmung in St. Gallen wird zeigen, wie die Bevölkerung denkt.
Des Weiteren werden 12 Anträge behandelt. Auch hier sei exemplarisch die Endlosdiskussion über die Realisation von Busbuchten erwähnt. Der Rat hält an seinem Entscheid fest, dass neue Haltestellen als Busbuchten zu konzipieren sind. Die Ratsmehrheit nimmt damit in Kauf, dass in vielen Fällen Grundeigentümer enteignet werden, um genügend Platz für Busbuchten zu erhalten. Die Ratsmehrheit beschliesst zudem faktisch ein Verbot von Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen und greift damit in hohem Masse in die Gemeindeautonomie ein und verhindert damit pragmatische und kostengünstige Lösungen für lärmgeplante Anwohnende. Freie Fahrt für freie Bürger!
Die Autodebatte dauert tatsächlich bis 15.20 h. Der Kanton scheint keine anderen Probleme zu kennen.
Die Herbstsession ist zu Ende. Im November steht das Budget 2024 zur Debatte.